| 23. April 2018 Fragen
sich Kunstschaffende eigentlich, welche künstlerischen Strategien zu entwickeln seien, um
die selbstgewählten Aufgaben zu bewältigen? Zur Erläuterung: Strategie meint ein
Konzept, wie man eine Sache erledigt, während Taktik einem das Verhalten in einer
konkreten Situation empfiehlt. Ich hatte mich für einen Input zum Symposium
„Kulturgeschichte in Bewegung: Das Fahrrad“ eingefunden.

Dabei mochte ich es, in der Kunsthalle
Graz mitten unter exquisiten Maschinchen zu sitzen, hauptsächlich aus der Puch
Mistral-Serie. Das sind Rennsportgeräte. Fahrräder aus vergangenen Tagen, penibel
restauriert. Teure Stücke in einem ausgewogenen Verhältnis von Belastbarkeit und
Eleganz. Ich hab hier [link]
eines der Rennräder herausgegriffen und dazu notiert, daß man seinerzeit im Ultima-Regal
zwischen 22.000,- und 30.000,- Schilling für ein vorzügliches Mistral Ultima ausgeben
mußte.
Um das Geld bekam man Anfang der 1980er schon einen sehr
ordentlichen Gebrauchtwagen. Mein Thema war „Wir sind Ikarier“, denn
ich bin gerade intensiv damit befaßt, den Stand der Mobilitäts-Phantasmen in unserer
Gesellschaft an den Mythen der Antike zu überprüfen, was eben auch einige starke
Verbindungen mit dem Thema Kunst zeigt.
Eingangs also: Fragen sich Kunstschaffende eigentlich,
welche künstlerischen Strategien zu entwickeln seien, um die selbstgewählten Aufgaben zu
bewältigen? Ich auf jeden Fall, weil mir die einzelnen künstlerischen Formen
unterschiedliche Optionen in einem größeren Prozeß sind, der sich auf konzeptuelle
Arbeit stützt, also auf Strategie.
Manche Menschen können sich leicht vorstellen, daß man
sich an Wein berauscht, haben aber keine Ahnung, daß Denkrprozesse ebenso berauschend
wirken können. Es kann zu einer weiteren Euphorie führen, solche Prozesse dann in
konkrete Vorhaben zu überführen. Das handelt mitunter von Zuständen, für die sich der
Begriff Flow eingebürgert hat. Ein antiquierteres Sprachbild bietet uns dafür
den "schöpferischen Menschen" an, der solche Befindlichkeiten kennt.

Den kann ich freilich nur in einer Tradition der
Aufklärung sehen, als uns Immanuel Kant empfahl, wir mögen unseren Verstand ohne
Anleitung durch andere gebrauchen, ergo selbstständig denken, womit der Philosoph den Ausgang
aus selbstverschuldeter Unmündigkeit betonte. Ein Weg in die Kunst erschiene mir
völlig sinnlos (auch aussichtslos), wenn er nicht dieser Empfehlung zur Autonomie folgen
würde.
Ich vermute, in genau dieser Brisanz, lag einer der
Gründe, daß ich in meinen Kindertagen bloß auf zwei dominante Motive stieß, welche mir
die Künstler in einer bipolaren Deutung gezeigt haben, wobei Künstlerinnen völlig
ausgespart blieben, nicht vorkamen. Hier das Genie, da der Bohemien. Hier der Erhabene, da
der Unruhestifter, Taugenichts.
Mir konnte erst sehr viel später klar werden, daß diese
zweiwertige Darstellung ihrerseits eine Strategie ausgedrückt hat, die in meinem Milieu
von einer Conditio sine qua non handelte. Wie sollte der hohe Anpasssungsdruck
die gewünschten Ergebnisse bringen, wenn allzuviel eigenständiges Denken zu
unkontrollierbaren Positionen führen konnte? Dieses Unkontrollierbare an der Kunst ist
vielen Menschen suspekt. Nicht nur Mächtigen, die jeweils anderen Menschen
Verhaltensänderungen aufzwingen können. Es stört vor allem auch jene, die sich das
selbst nicht erlauben.
Nun ist aber die Kunst auf solche Optionen des Denkens ohne
Anleitung anderer angewiesen. Hier also der faule Kompromiß. Wenn schon, dann aber im
Dienste der Erhabenheit und letztlich im Rang eines Genies, am besten in der
Oberklasse: als Universalgenie. Dagegen muß der Bohemien als
Kontrastmittel herhalten und da er als "Bürgerschreck" firmiert, wissen wir,
daß er bürgerliche Tugenden vermissen läßt, ergo die bürgerliche Ordnung stört.
In genau diesem Kontext gibt es dann noch so manche
Sonderform, wie etwa den schrillen Vogel, der den Bohemien imitiert (buntes Käppchen,
schrille Brillenfassung etc.), um sich als Künstler zu empfehlen, welcher er in der Regel
nicht ist, soweit man am bestehenden Werk bemessen kann. Der hat eine spezielle Funktion.
Diese Typus boomt übrigens zur Zeit in männlichen und
weiblichen Versionen. Da geht Sichtbarkeit vor Authentizität und der Deal mit
Funktionstragenden besteht hauptsächlich darin, einen Kunstbetrieb zu simulieren, der
inhaltlich keine Probleme aufwirft, der in der Abwicklung lästige Fragen ausspart.

Damit meine ich, hier profilieren sich neuerdings wieder
Spießer und Mittelschicht-Trutschen, die der Funktionärswelt eine kuriosen
Leistungsaustausch anbieten: Sichtbarkeit gegen Willfährigkeit. Damit werden wesentliche
Teile der knappen Kulturbudgets für andere Zwecke frei und es lassen sich nebenbei Serien
von Pressefotos generieren, auf denen derlei launige Künstler-Imitationen für
gewöhnlich zwischen wenigstens drei bis meist sechs Personen aus Politik und Verwaltung
eingekeilt dastehen. (Die Intention ist durchsichtig.)
| Wir haben derzeit
keinen breiten gesellschaftlichen Konsens, daß die aktuelle Modernisierungskrise, wie sie
uns von der Vierten Industriellen Revolution auferlegt ist, verlangen würde,
eine besondere Anstrengung im Kulturbereich zu erbringen, um die eigene Zukunftsfähigkeit
zu erarbeiten. So hat es etwa Historiker Philipp Blom
in "Der taumelnde Kontinent" beschrieben, als Deutschland im 19.
Jahrhundert daran ging, England, damals erste Industriemacht der Welt, zu überflügeln.
Das handelte unter anderem von einer exorbitanten Investition in alle Bereiche
der Kultur, um so Denkräume aufzumachen.
Das hatte auch Portugal auf dem Weg in die Renaissance
erkannt und es damals durch einen Import von Wissen angepackt, der in adäquaten
Einrichtungen ausgewertet wurde. Prägnantes Ergebnis war der neue Schiffstyp der Karavellen. |
 |
Dadurch hat sich dann die Welt völlig
verändert, freilich zum Nachteil jener Völker, die plötzlich Konquistadoren und
Kolonialherren am Hals hatten. Wie nun dieser Input zum Symposion in der Kunsthalle
Graz den Titel „Wir sind Ikarier“ trug, werde ich die erwähnen
Aspekte am kommenden Wochenende auf Schloß Freiberg in "Die Gefolgschaft des
Ikarus" zur Debatte stellen. Ich hab mich hier in der Notiz "Die Beuyse des Pessler"
auf den Künstler Klaus Rinke bezogen. In seinem Brief an die Neuzugänge der Rinke-Klasse
kommt folgende Passage vor:
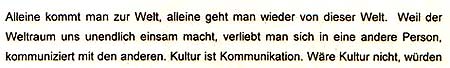
Das korrespondiert mit den alten Vorstellungen des
Verhältnisses zwischen Muße und Arbeit. Im Bogen von Aristoteles zu
Thomas von Aquin schien noch klar zu sein, daß wir arbeiten, um Muße zu haben, nicht
umgekehrt. Das findet man so in historischen Texten. Wie bemerkenswert, daß heute eine
gängige Redensart genau das ausdrückt: "Wir leben nicht, um zu arbeiten, wie
arbeiten um zu leben."
Dazu paßt übrigens auch, was die Begriffe andeuten. Das
lateinische Wort Otium für Muße, als Gegenteil von Negotium
für (Alltags-) Arbeit, hat im Griechischen eine überraschende Entsprechung. Das
Wort für Muße lautet dort Schule (sxo'li). Die Schule ist
also in unserer Kultur ursprünglich nicht Kadettenanstalt, sondern ein Ort der
Muße, an dem sich Wahrnehmungs-, Reflexions- und Erkenntnisprozesse einstellen können,
doch nicht müssen,
Nun sind ja nicht alle unsere Schulen Kadettenanstalten,
aber offenbar sehr viele, wenn man den Zustand von Österreichs Bildungssystem kritisch
betrachtet. Zu dieser Debatte habe ich freilich nichts mehr beizutragen. Doch ich muß
darauf bestehen, das Feld der Kunst als ein Bezugssystem vorzufinden, in dem Muße eine
fundamentale Rolle spielt.
-- [Das Fahrrad-Symposion] [Die Quest III] -- |