22. Jänner 2025
Politik-Karaoke: Konsequenzen
II
Das altgriechische Wort Politiká stand
als Sammelbegriff für „die politischen Belange“, im
Wesentlichen für die „Staatskunst“. Gehen wir davon aus, daß
Politik heute nicht bloß das sein kann, was
Funktionstragende der Staatskunst tun, also Leute des
Funktionärswesens, sondern erst das, was im Wechselspiel
zwischen Staatskunst und Gemeinwesen (Polis) entsteht.
Ich sehe dabei drei Sektoren im Zusammenhang: Staat,
Markt und Zivilgesellschaft. Das meint Leute aus Politik und
Verwaltung, Wirtschaftstreibende und schließlich
Privatpersonen sowie auch juristische Personen (Vereine).

Großes Kino oder lieber kleinere
Formate?
Daß politisches Personal eigene Interessen
verfolgt, halte ich für legitim, solange das
mit angemessener Transparenz geschieht. Wo
Leute in der Verwaltung eigene Interessen
verfolgen, sehe ich wachsende Probleme. Sie
sind Dienstleister und sollten keinesfalls
Programm machen. Dafür müßten sie den Job
wechseln, in die Politik, ins
Kulturmanagement oder in die Kunst gehen.
In der Steiermark ist dieses Problem
akut. Zu viele ambitionierte Leute in der
Verwaltung, welche die Sicherheit ihrer Jobs
schätzen, sich dabei mitunter den falschen
Aufgaben widmen. Außerdem sehe ich, daß
Kulturpolitik nun wieder stärker denn je als
Identitätspolitik gebeugt, stellenweise
sogar mißbraucht wird. Wenn Kunst-
und Kulturschaffende sich daran nicht
stoßen, wenn wir darüber auch keinen offenen
Diskurs haben, kommt das unter anderem
daher, daß längst zu viele merkwürdige
Allianzen entstanden sind.
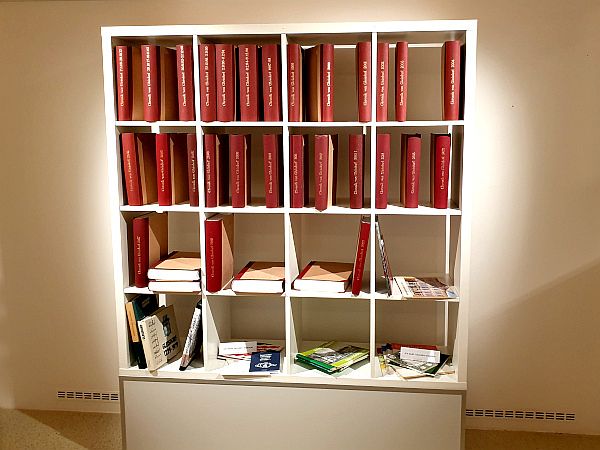
Welches Genre? Welches Konzept?
Welche Interessensgruppe?
Ein Denkanstoß: In der traditionellen
Arbeiterbewegung wäre es undenkbar
gewesen, daß Leute aus der Gewerkschaft
mit Leuten aus dem Betriebs-Vorstand
dienstlich wie privat gemeinsame Sache
machen. Unübersehbare
Interessenskonflikte. Im steirischen
Kulturbetrieb sind vergleichbare
„Freundschaften“ längst normal.
Wir hatten in den 1990ern österreichweit
debattiert, was zu den drei Sektoren
(Staat, Markt, Zivilgesellschaft) an
Rollenklarheit gebraucht wird und was
das für kulturpolitische Konsequenzen
haben sollte. Ich vermute, wer heute die
IG Kultur Steiermark und ähnliche
Formationen verkörpert, war damals nicht
dabei. Dieser Diskurs fehlt mir völlig.
Wenn wir uns einigen könnten, daß
die Funktionstragenden der Politik weder
unsere Ressourcen, noch unsere
Dienstboten sind, sollten wir gerüstet
sein, mit ihnen zu verhandeln, aufgrund
welcher Kriterien verfügbare Mittel nach
welchen Zielsetzungen verwendet werden
mögen. (Der Appell „Kunst und Kultur
sind wichtig, also her mit der Marie!“
ist ein Ausdruck von Inkompetenz.)

Die Club-Dimension ist
allerweil bewältigbar.
Es wäre zu klären, welche Rollen und
Aufgaben in einem gemeinsamen
Vorhaben zur Wirkung kommen sollten.
Dieses gemeinsame Vorhaben, nämlich
im Gemeinwesen für ein geistiges
Leben von Relevanz zu sorgen, muß
seinerseits auch konzipiert und
verhandelt werden. Das also wäre
eine Praxis der Kulturpolitik, die
ich für erstrebenswert halte.
Dazu ist es unverzichtbar, über
die verschiedenen Genres mehr
Klarheit zu haben, als sie derzeit
offenkundig herrscht. Wer nach den
letzten 30 Jahren immer noch mit dem
Begriffstrio „Volkskultur,
Hochkultur und freie Szene“
auskommt, ist solchen Aufgaben
erkennbar nicht gewachsen. Aber an
diesem Defizit kann man schließlich
arbeiten. [Fortsetzung
folgt!] +)
Kulturpolitik
PostskriptumEines
unserer Prinzipien verlangt von uns,
im Archipel Aktion und Reflexion
verknüpft zu halten. Das heißt, wir
sind auch auf der Metaebene aktiv,
um überprüfen zu können, wie es mit
der laufenden Arbeit vorangeht.
Siehe zum Beispiel: +)
Mirjana Peitler: Kollektive
Kreativität+)
Monika Lafer: Kunst, ortsgebunden
[Kalender]
[Reset]
|
|